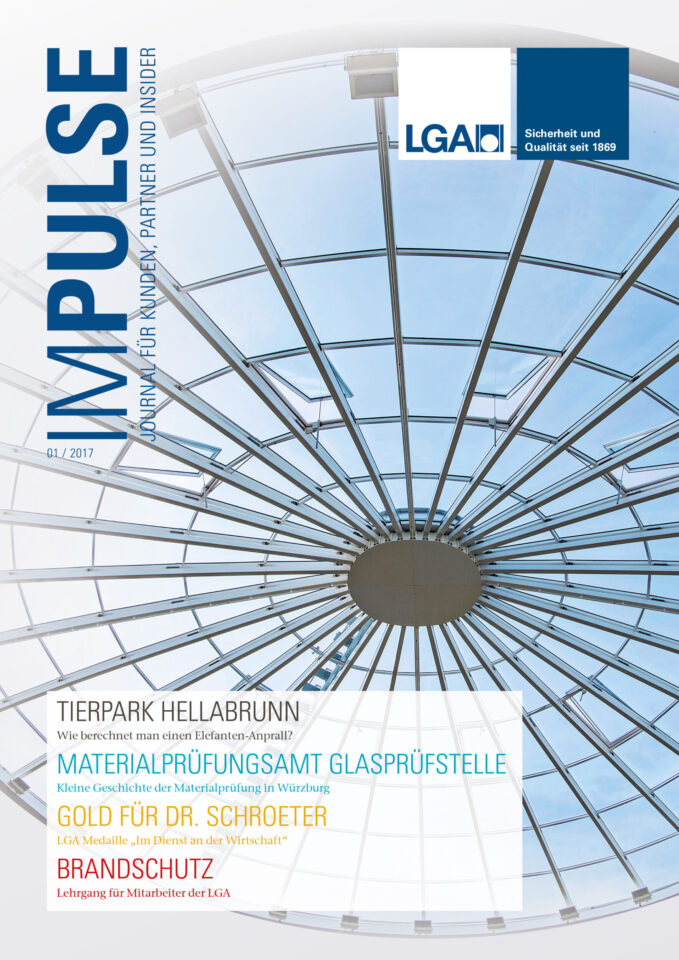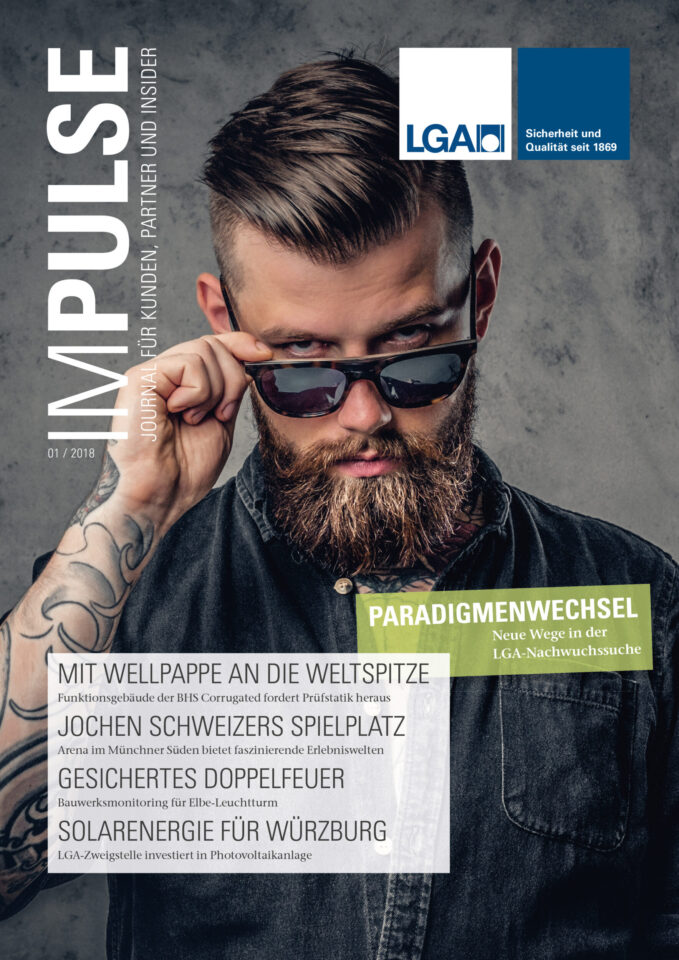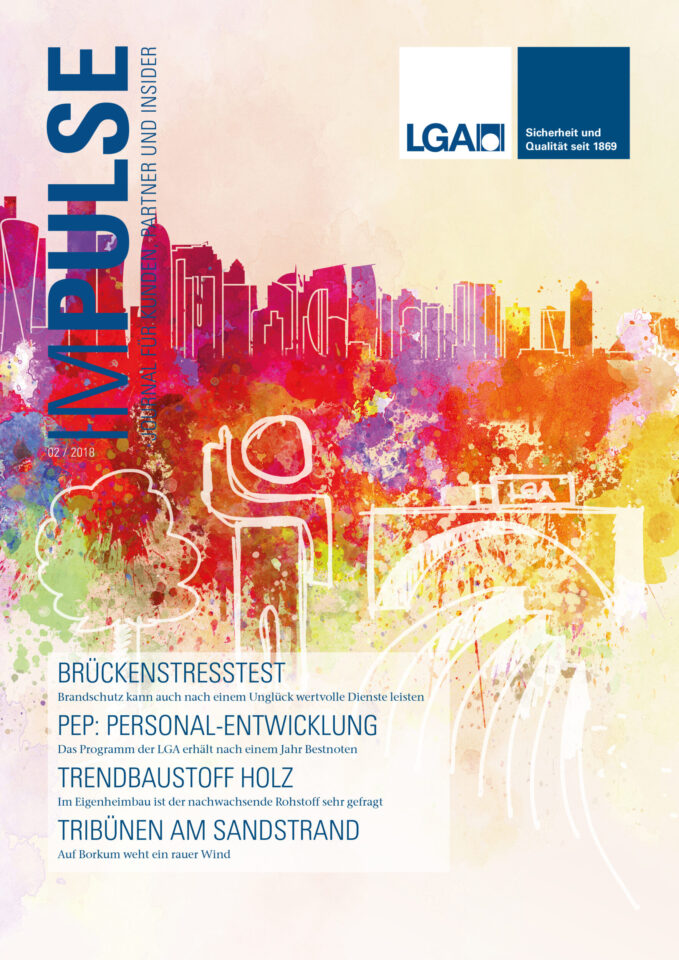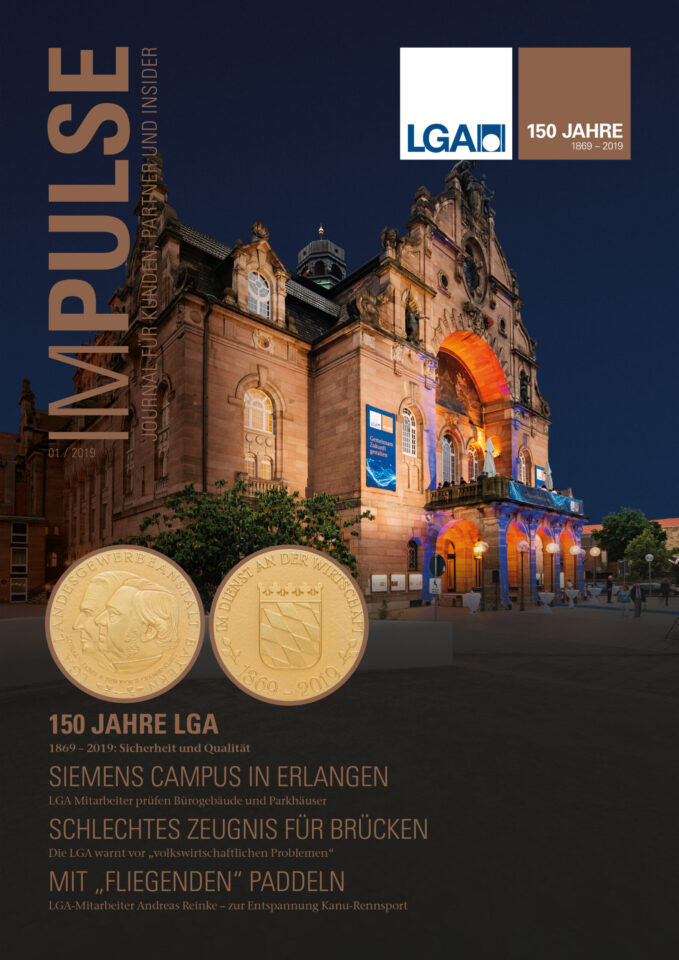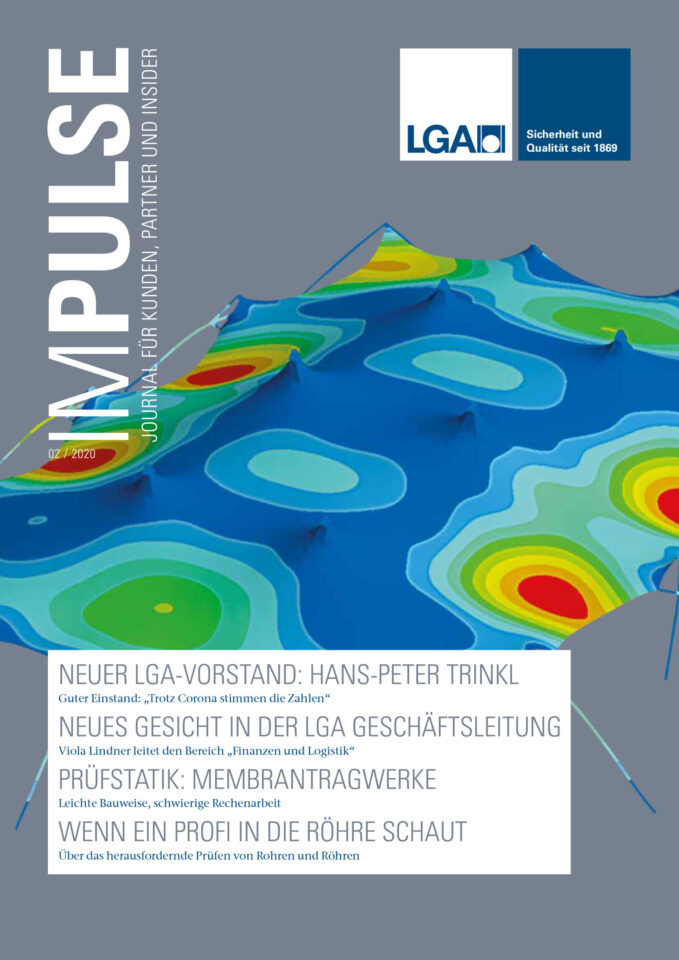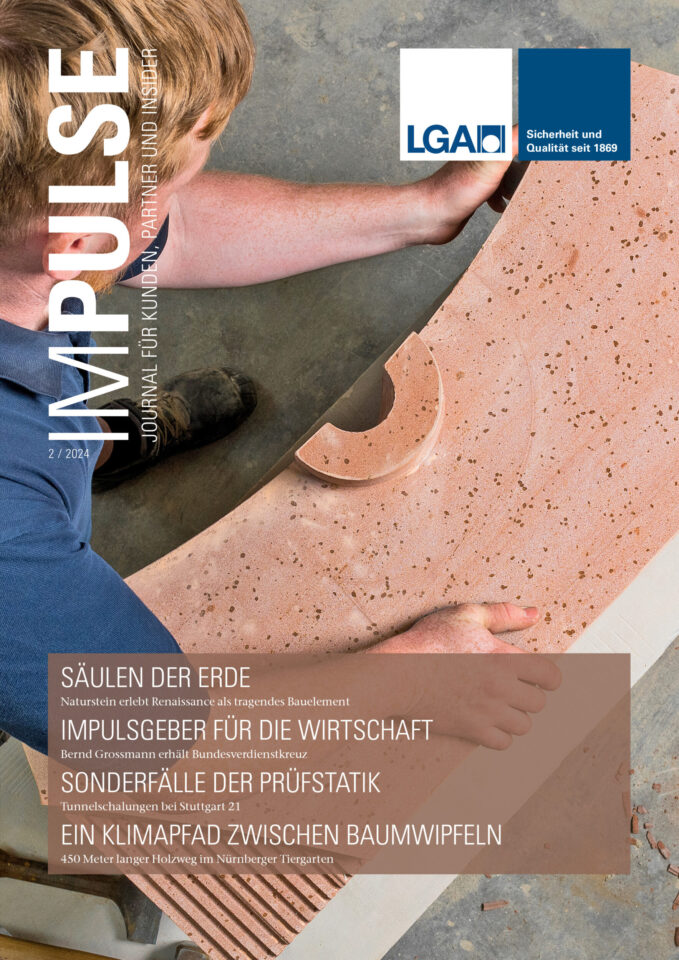VERTIEFTE PRÜFUNGEN VON STAUANLAGEN
Die Folgen des Klimawandels sind auch in Mitteleuropa nicht mehr zu übersehen: „Es regnet deutlich häufiger heftig. Ungewöhnlich starke Niederschläge kommen heute in Deutschland doppelt so häufig vor wie vor 100 Jahren. Die Durchschnittstemperaturen steigen, warme Luft kann sehr viel mehr Wasser aufnehmen, so dass auch die potenziellen Niederschlagsmengen größer sind.“ (wwf.de/Hochwasser) Das bedeutet gleichzeitig, dass die Sicherheit von schützenden Anlagen immer höhere Priorität genießt. Prognosen über zu erwartende Niederschläge und die Folgen mithilfe digitaler Modelle unterstützen diese Arbeit.
Insgesamt gewinnt der Hochwasserschutz immer mehr an Bedeutung. Durch die vermehrte Errichtung von Stauanlagen und die turnusmäßige Prüfung und Instandhaltung von vorhandenen Bauwerken versucht man Schäden durch Hochwasser zu vermeiden. Diese „müssen dem standhalten, wofür sie gebaut wurden“, so beschreibt die Bauingenieurin Barbara Koch, Referatsleitung Grundbau bei der LGA die Aufgabe, für Sicherheit und Qualität solcher Anlagen zu sorgen. Die Betreiber von Stauanlagen sind dazu verpflichtet, deren ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu überwachen, so die Vorschrift, die Einzelheiten sind in der DIN 19700 festgelegt. Neben der permanenten Überwachung der Anlagen ist alle drei bis fünf Jahre eine vertiefte Prüfung erforderlich, so verlangt es der Gesetzgeber.
Diese „Überwachungen“ erfolgen in mehreren Schritten. Als erstes werden die Bauunterlagen, so vorhanden, gesichtet und auf Vollständigkeit geprüft. Dann wird die Stauanlage mit allen Bestandteilen in Augenschein genommen. Der Prüfer stellt Fragen wie „Ist der Damm noch standsicher?“, „Was geschieht bei einer möglichen Überflutung?“ oder „Verträgt der Damm Schwerlastverkehr?“. Unter anderem wird gemessen, wie schnell Wasser versickert. Es werden Bodenproben entnommen und Bohrkerne im Labor untersucht, um den Zustand im Inneren einer solchen Anlage zu überprüfen. „Wir versuchen, einen möglichst exakten Blick in die Anlage zu werfen“, so Koch.
Auch für solche Prüfungen hat sich in der LGA die fachübergreifende Zusammenarbeit bewährt: Das Referat Grundbau hat die oben beschriebenen Aspekte bearbeitet, mit Unterstützung der LGA-eigenen Labore. Mitarbeiter vom LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten, wie die Geologin Dr. Nina Forster und der Bauingenieur Dominik Kisskalt, haben sich mit dem LGA Grundbau bei einem Projekt in der Oberpfalz bei Trockental die Aufgabe geteilt. Die Fragen, die Prüfer stellen, enden nicht mit dem Status quo der Anlage. Zuverlässige, auf Berechnungen beruhende Prognosen gehören dazu. Nicht nur der Zustand der Anlage in der Zukunft, sondern auch das Geschehen im Hochwasserfall müssen analysiert, festgehalten und ggf. Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Moderne Computerprogramme und digitale 3-D-Modelle helfen für Aussagen über den Ernstfall: Aussagen wie „nach 19 Stunden Dauerregen würde der Damm überlaufen“, liegen komplexe Berechnungen zugrunde, die viele Parameter einbeziehen. „Hier liegt der Teufel im Detail“, weiß Dr. Forster. „Ein buntes Bild ist schnell erzeugt, aber stimmt dies dann auch mit der Realität überein?“, ergänzt ihr Kollege. Mehrstufige Simulationsprozesse sind erforderlich, um zuverlässige Prognosen zu erstellen. Kartenanimationen mithilfe der Software Mapview Hydrotec ermöglichen anschauliche Einschätzungen.
Zum Abschluss solcher Aufträge gehört es auch, ein aktuelles Stauanlagenbuch zu erstellen, inklusive Betriebsanweisungen für den Erhalt der Anlage. „Bei der Prüfung von Stauanlagen erwarten wir zukünftig einen stark steigenden Bedarf“, macht Dominik Kisskalt das Potenzial dieser Sonderaufgaben klar.