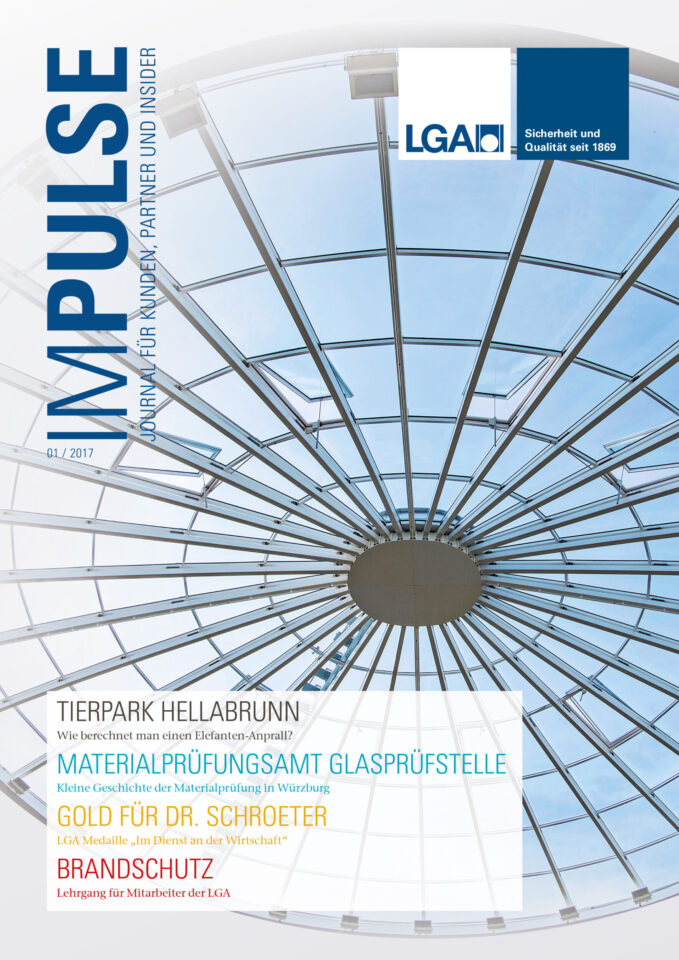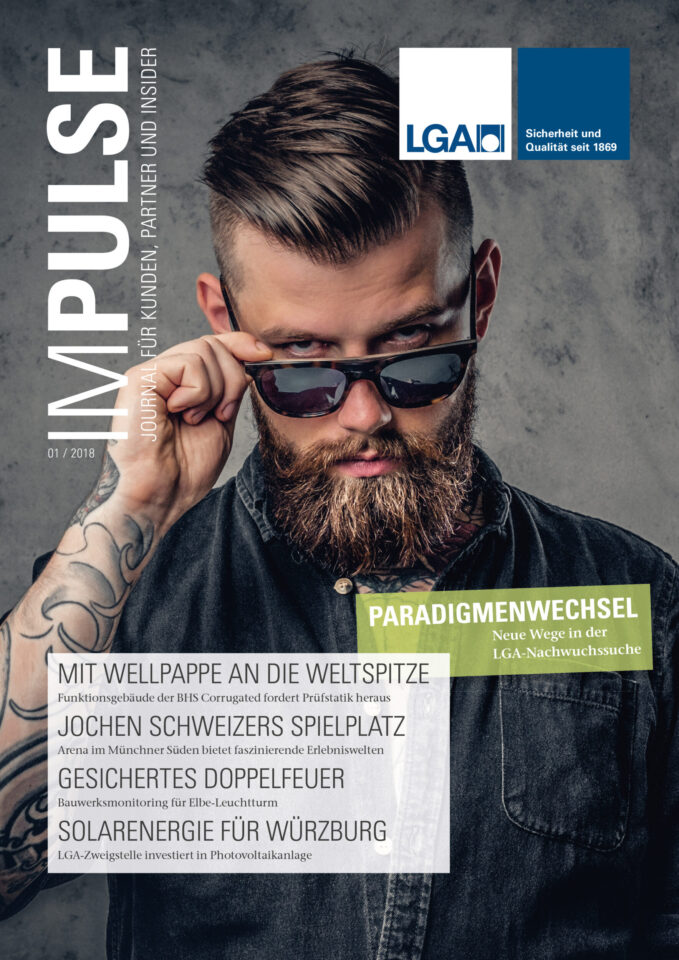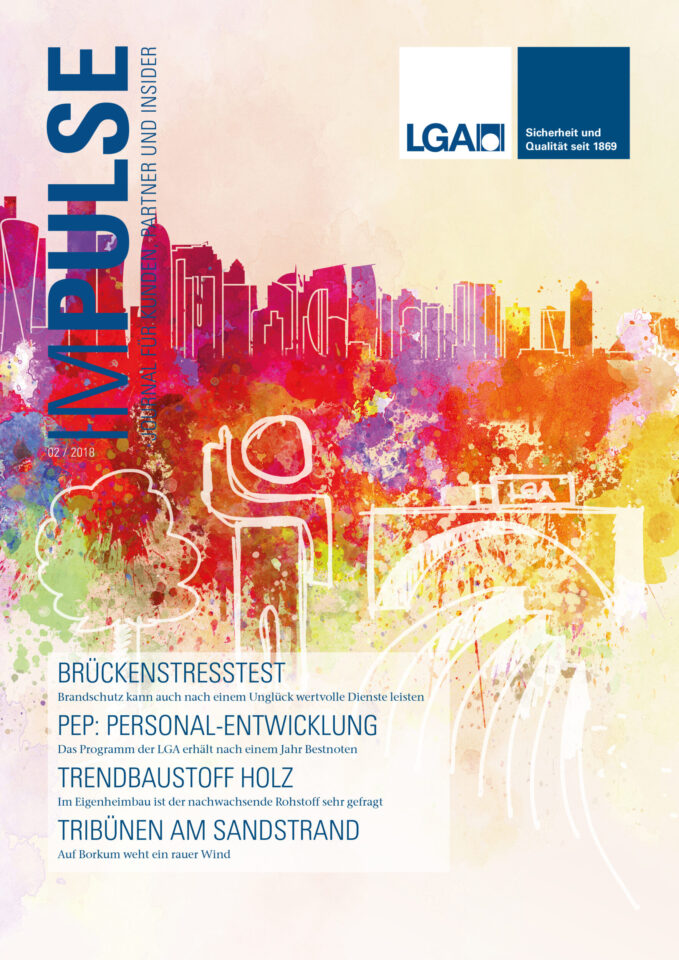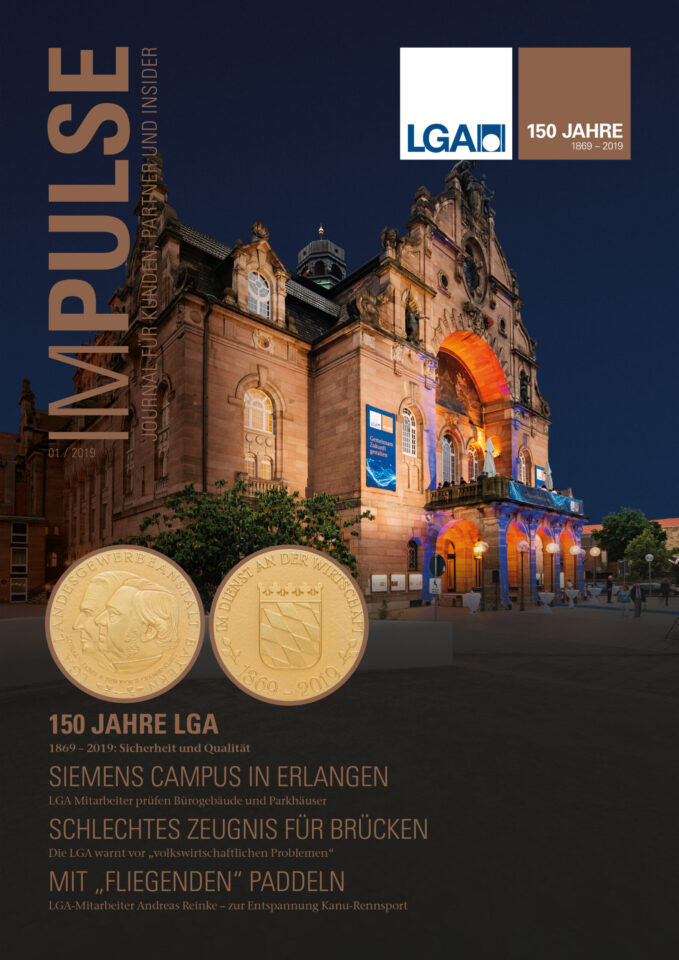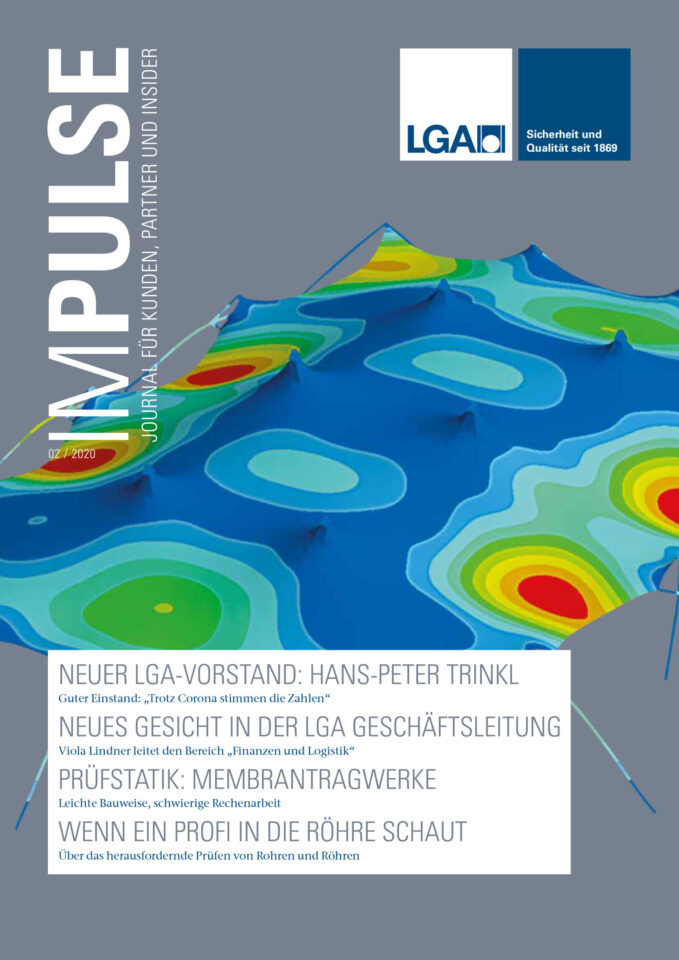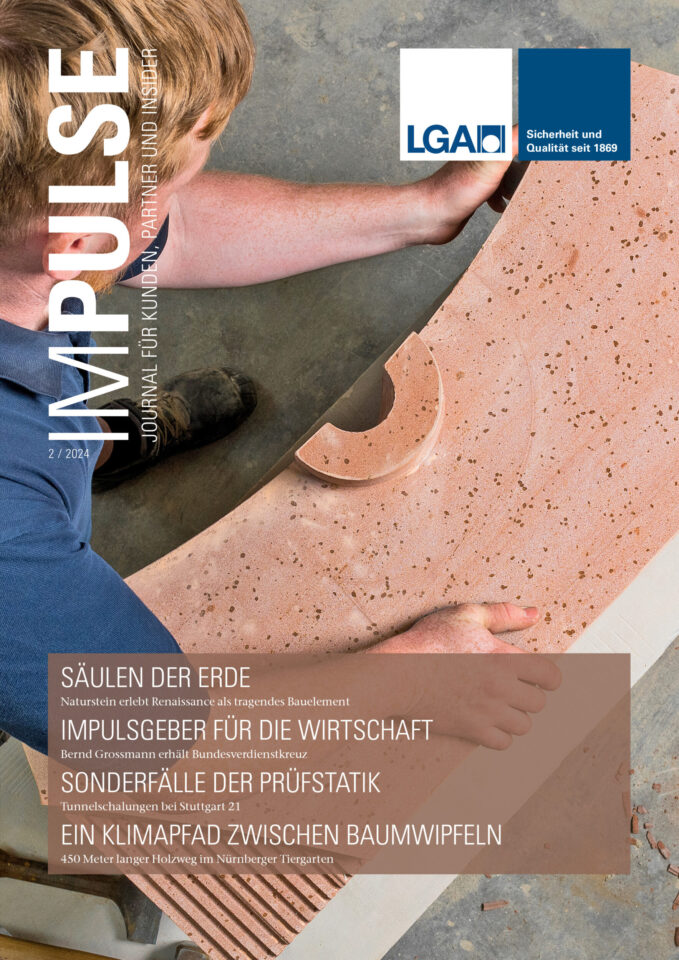Das Thema Nachhaltigkeit spielt gerade in der Baubranche eine große Rolle. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) formuliert diese Definition: „Nachhaltiges Bauen ist ganzheitlich und lebenszyklusorientiert.“ Das gilt für alle Bereiche der Baubranche. Doch Selina Radeke von der LGA hat in ihrer jüngst fertiggestellten Masterarbeit herausgearbeitet, dass nicht alle Kriterien der Hochbau-lastigen DGNB in gleicher Weise auf die Geotechnik und den Verkehrswegebau übertragbar sind.
Drei Kriterien gehören laut DGNB zum nachhaltigen Bauen: „der Nachhaltigkeitsansatz basiert auf einem Dreisäulenmodell, bestehend aus: Ökonomie, Ökologie und Sozialem“. „Da beginnen schon die Unterschiede zwischen Hochbau und beispielsweise einem Projektbeispiel an einer Autobahn des Bundes“, so Radeke, „denn die sozialen Kriterien fallen dabei nicht so in die Waagschale“.
Das versteht man besser, wenn man das Thema der Masterarbeit ansieht, welches lautet: „Vergleich zweier Varianten zur Herstellung einer versteilten Böschung im Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte“. In Radekes Arbeit geht es um einen Vergleich, nämlich die „Versteilung eines Fahrbahndamms mit Hilfe qualifizierter Bodenverbesserung bzw. einer Kunststoff-Bewehrte-Erde- Konstruktion (KBE-Konstruktion)“.
Der Wert von Radekes Arbeit für die Praxis – das Thema wurde von ihrem Vorgesetzten, Dieter Straußberger, ins Spiel gebracht, ist bedeutsam. Denn bislang scheiterte die Nachhaltigkeitsbewertung einzelner technischer Varianten in der Geotechnik und dem Tiefbau daran, dass anders als im Hochbau keine Referenz- und Vergleichswerte zur Verfügung stehen. Zu Radekes Fallbeispielen gab es jedoch bereits eine Untersuchung des Kollegen Ernst Stapff, LGA, mit zahlreichen Daten. Darauf konnte sie zurückgreifen. Nun ist ein Anfang gemacht, Kriterien aus dem Hochbau wurden abgewogen, modifiziert und an die konkreten Untersuchungsbeispiele angepasst. Diese wurden detailliert untersucht.
Im ökonomischen Bereich „geht es um Ressourcen“, so Radeke, „um jede Art, wie man nachhaltig wirtschaften kann. Das sind Aufträge des Bundes, also Steuergelder, sie müssen sorgsam eingesetzt werden.“ Ein ökologischer Aspekt beim konkreten Autobahn-Verbreiterungs- Auftrag ergab sich u. a. aus der Vorgabe der Planer, dass Flora und Fauna trotz Bau nicht angetastet werden durften. Eine Lösung, die sich anbot und der Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen wurde, lautete „steiler bauen“.
Für Selina Radeke ging es jedoch vor allem darum, wie sich die Nachhaltigkeitsaspekte der beiden Varianten, mit denen die versteilte Böschung gebaut werden kann, über ihren Lebenszyklus verhalten. Beim ökologischen Aspekt ging es z. B. um den Ausstoß von Treibhausgasen, den Verbrauch von Ressourcen wie Primärenergie und Wasser, das Abfallaufkommen durch die Baustoffe oder die verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung der Baustoff-Hersteller. Beim ökonomischen Aspekt ging es um Lebenszykluskosten, die Anpassungsfähigkeit und die Klimaresilienz der Bauwerke.
Was am Ansatz der DGNB und der Masterarbeit besonders ist, ist die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks. Hier ergeben sich signifikante Unterschiede zum Hochbau, da die Bauphase bei den Nachhaltigkeitsaspekten besonders ins Gewicht fällt. Bei einem Wohngebäude z. B. hat die nachfolgende Nutzungsphase einen deutlich größeren Einfluss. Im Erdbau spielt sie jedoch so gut wie keine Rolle. „Noch ist das Thema Nachhaltigkeit nicht im Grundbau verankert. Es kommt langsam dort an. Aber es wird schnell wachsen, die Klimakriterien gelten überall. Und wir sind bereit“, sagt Selina Radeke.